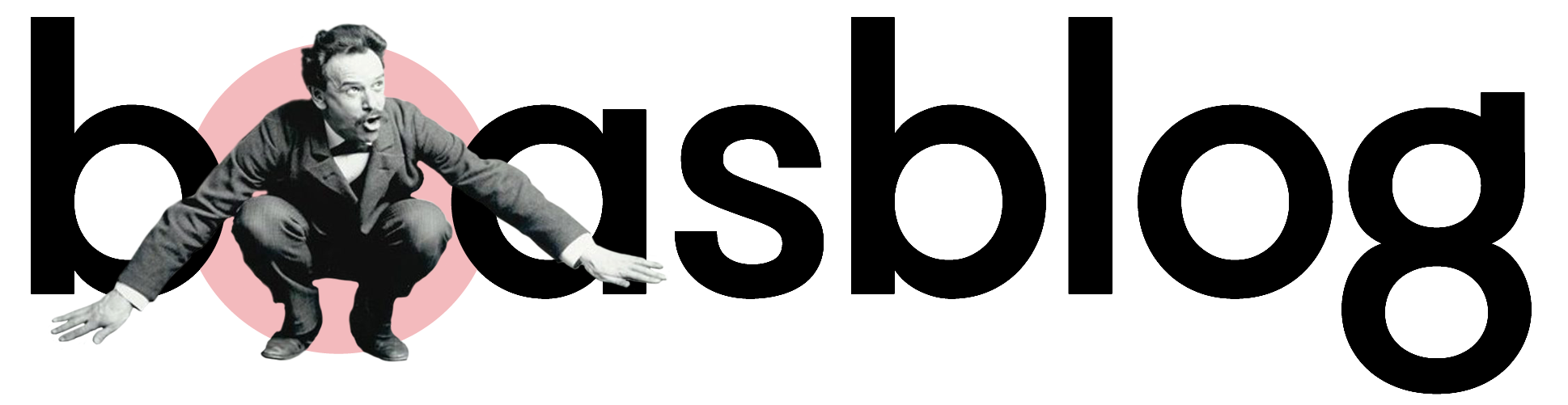Urban Super Food vs. Rural Staple Food
(Re)discovering Ragi in Bangalore and South Karnataka
Einleitung
Im Jahr 2023 setzte der G20-Gipfel in Neu-Delhi ein bemerkenswertes Signal. Anstelle des üblichen, fleischlastigen Menüs entschied sich Premierminister Narendra Modi für ein rein vegetarisches Galadinner für seine internationalen Gäste. Eine besondere Rolle als Bestandteil jedes Gangs spielte dabei eine Getreideart, die in Indien bereits seit Jahrtausenden verbreitet ist, jedoch über Jahrhunderte hinweg als marginal galt: die Hirse. Diese Entscheidung war nicht nur eine kulturpolitische Geste, sondern knüpfte unmittelbar an die Erklärung der Vereinten Nationen an, das Jahr 2023 – auf Initiative Indiens – zum „International Year of Millets“ auszurufen. Hirsearten werden heute als klimaresistent, ernährungsphysiologisch wertvoll und vielversprechend im globalen Kampf gegen Hunger betrachtet, weshalb sie mit dieser Kampagne mehr in den Fokus der Welternährung gebracht werden sollten.
Innerhalb dieses größeren Rahmens nimmt meine Masterarbeit die Fingerhirse, im südindischen Bundesstaat Karnataka als Ragi bezeichnet, in den Blick. Die Geschichte dieser Pflanze ist von Ambivalenzen geprägt. Einerseits bildet Ragi in vielen ruralen Regionen Südindiens seit Jahrhunderten ein schnell wachsendes und langanhaltend sättigendes Grundnahrungsmittel. Andererseits wurde Ragi in urbanen Zentren, insbesondere in Bangalore, lange Zeit als grobkörniges und braunes „Armenessen“, im Gegensatz zum feinkörnigen, weißen Reis, stigmatisiert. In jüngerer Zeit erfährt Ragi jedoch eine Neubewertung. Angesichts einer steigenden Anzahl an sogenannten Wohlstandserkrankungen wie Diabetes oder Übergewicht und im Zuge globaler Ernährungstrends – überwiegend im Fast-Food-Bereich – gilt sie heute in urbanen Mittelschichten als „Superfood“.
Meine zentrale Forschungsfrage lautet daher: Wie prägen die materiellen Eigenschaften von Ragi und ihre kulturellen Interpretationen soziale Differenzierungen zwischen ruralen und urbanen Kontexten in Südindien? Um diese Frage zu beantworten, verbinde ich dabei Perspektiven aus Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Entwicklungsökonomie mit meinem ethnologischen Hintergrund. Ragi wird dabei nicht nur als Pflanze, sondern zugleich als kulturell aufgeladenes Lebensmittel betrachtet.
 Abb. 1 Ragi Puttu Fotocredit: Vaidehi Pujary, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Abb. 1 Ragi Puttu Fotocredit: Vaidehi Pujary, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Theoretischer Rahmen
Die Masterarbeit kann im Feld der Kulinarischen Ethnologie verortet werden. Damit schließe ich an eine lange Kontroverse über die lebensnotwendige einerseits und eine kulturelle Rolle von Nahrung andererseits, und einen separaten Arbeitsbereich innerhalb der Ethnologie an. Im Sinne von De Garine bedient sich eine Kulinarische Ethnologie gerade solcher Widersprüche und versucht an diesen Reibungspunkten entstehende Forschungsfragen unter Einbindung separater Disziplinen zu beantworten. Dieses Phänomen kann jedoch in der Geschichte der Kulinarischen Ethnologie nicht unbedingt als neu betrachtet werden. Bereits in den 1930er Jahren untersuchte Audrey Richards in funktionalistischer Tradition Ernährung als Grundlage sozialer Organisation und versuchte dabei Ernährungswissenschaften miteinzubeziehen. Umgekehrt versuchte Marvin Harris verschiedenste Esskulturen über ökologische und ökonomische Faktoren zu erklären, jedoch ohne Einbezug der darin handelnden Akteur*innen. Schließlich hat Sidney Mintz mit seiner kulturhistorischen Studie zum Zucker mithilfe von Ansätzen und Methoden unter anderem aus der Humanbiologie und den Ernährungswissenschaften gezeigt, wie Lebensmittel in unterschiedlichen Epochen und sozialen Milieus radikale Bedeutungsverschiebungen erfahren können.
Um dahingehend zu verstehen, wie sich Ragi über die Jahrhunderte bis heute von einem Grundnahrungsmittel in ruralen Gebieten, zu einem urbanen „Super Food“ entwickeln konnte und im Kontext des New Materialism, orientierte ich mich an Tim Ingolds materialitätsorientiertem Ansatz. Er betont, dass Materialien nicht lediglich passive Substrate seien, denen Menschen eine entsprechende materielle Bedeutung zuschreiben, sondern dass diese durch ihre Eigenschaften aktiv an diesen Prozessen mitwirken. Übertragen auf Ragi bedeutet dies, dass dessen Nährstoffzusammensetzung, die Robustheit im Anbau, die Sättigungseffekte und die gesundheitsfördernden Eigenschaften, entscheidend für jene kulturellen Zuschreibungen sind, die es dadurch in verschiedenen sozialen Kontexten erfährt. Für dieses Verständnis ist es wichtig, die besagten anderen Disziplinen mit einzubeziehen, was in meinem Fall Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Entwicklungsökonomie betraf.
Um zu verstehen, wie und in welchen Formen (als Getreidekorn, Pflanze, gemahlen oder unterschiedlich zubereitet) Ragi zwischen ruralen und urbanen Gegenden zirkuliert und so sozio-kulturelle Interpretationsverschiebungen erfährt, wählte ich für meine Feldforschung eine methodologische Orientierung an der Multi-Sited Ethnography nach George Marcus. Diese ermöglichte es, Ragi nicht nur an einem einzelnen Ort, sondern entlang seiner unterschiedlichen Interaktionskontexte zu verfolgen.
Letztendlich kann Ragi damit als ein klassisches Fallbeispiel für die NatureCultures-Debatte gesehen werden, welche die Untrennbarkeit von Natur und Kultur hervorhebt. Nahrung ist nicht entweder naturgegeben oder kulturell gedeutet, sondern immer beides zugleich.
Methodik
Als empirische Grundlage führte ich zwischen Februar und September 2022 im Rahmen eines Austauschsemesters an der University of Agricultural Sciences (UAS) Bangalore eine ethnologische Feldforschung durch.
Meine dafür gewählten Forschungsmethoden waren hierbei vielfältig. Um zunächst einen Überblick über die naturwissenschaftlichen Eigenschaften bzw. Materialität von Ragi zu erwerben, nahm ich an Lehrveranstaltungen des Department of Food Science and Nutrition mit den Kursen „Principles of Nutrition“ und „Principles of Community Nutrition“ sowie am Department of Agronomy mit dem Kurs „Agronomy of Major Cereals and Pulses“ teil. Insbesondere in letzterem Kurs führte ich eine Teilnehmende Beobachtung durch, indem ich als praktischen Teil Ragi-Pflanzen auf den universitären Versuchsfeldern anbauen konnte und mir so die landwirtschaftliche Materialität von Ragi vor Augen führen konnte.
Anschließend führte ich fünf Leitfadeninterviews – die meisten mit teils biographischem Inhalt – mit Gesprächspartner*innen durch, welche jeweils unterschiedliche Berührungspunkte mit Ragi haben.
- Ein Bekannter einer Freundin von mir: er und seine Familie stammen direkt aus Bangalore: Ragi wird ca. einmal in zehn Tagen in Form von Ragi-Rotti konsumiert
- Eine Kommilitonin aus der Region um das sogenannte „Ragi-Zentrum“ Mandya, ihre Familie betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb: Ragi wird meist zwei Mal täglich konsumiert und auch für die Dorfgottheiten und um Hochzeitsfeiern serviert
- Eine weitere Kommilitonin, jedoch aus der Grenzregion zu Nordkarnataka, Davanagere: sie hat keine direkten Verbindungen zu Landwirtschaft und Ragi wird in ihrer Familie nur sporadisch konsumiert, allerdings dient es ein Mal pro Jahr als Zutat für eine Süßigkeit zu Diwali namens Shandigge Huggi
- Der Onkel einer Kommilitonin aus der Hassan-Region westlich von Bangalore: er ist Landwirt, führt den elterlichen Betrieb fort und baute ursprünglich vor allem Ragi an; inzwischen jedoch am meisten Reis, Kartoffeln und Hülsenfrüchte; zu den traditionellen südindischen Festen Suggi Habba Mitte Januar und Ayudha Puja im Oktober wird Ragi, meist als Ragi-Mudde, serviert
- Ein Mitarbeiter eines in Bangalore ansässigen Unternehmens, welches unter anderem Fertigprodukte auf Ragi-Basis für den urbanen Markt produziert und sich darin als Vorreiter sieht (Online-Interview)
Diese Kombination unterschiedlicher Perspektiven und damit Interaktionen mit Ragi bzw. seiner Materialität, erlaubte es mir, sowohl traditionelle Anbau- und Zubereitungspraktiken aus eher ruralen Gegenden als auch urbane Vermarktungsstrategien in den Blick zu nehmen und zu vergleichen.
Ergebnisse
Seit seiner Einführung, wahrscheinlich zwischen 1800 und 1390 v. d. Z. aus dem heutigen Uganda, bildete Ragi über die Jahrhunderte ein zentrales Grundnahrungsmittel in Südindien. Im Laufe der Geschichte verlor die Pflanze jedoch an Prestige. Mit der Etablierung des Reisanbaus – befördert durch religiöse Praktiken der von Norden vordringenden Brahmanen sowie durch koloniale Handelsstrukturen – wurde Reis zum bevorzugten Getreide. Reis erlangte eine starke symbolische Aufladung in Ritualen und galt als wertvolles Handelsgut. Ragi hingegen wurde zunehmend an den Rand gedrängt und schließlich als „Armenessen“ stigmatisiert.
Im Nachhinein lässt sich diese Entwicklung auch durch die – inzwischen mittels Naturwissenschaften ermittelten – physiologischen und agronomischen Materialitäten von Ragi begründen. Ragi zeichnet sich durch einen bemerkenswerten Nährwert aus. Das Getreide enthält hohe Anteile an Eiweiß, Calcium, Eisen und Ballaststoffen. Besonders hervorzuheben ist der Calciumgehalt, der – genauso wie die meisten genannten Nährstoffe – im Vergleich zu Reis deutlich höher liegt. Damit kann Ragi zur Prävention von Mangelerscheinungen beitragen. Darüber hinaus wirkt sich der hohe Ballaststoffanteil positiv auf die Verdauung aus und sorgt einerseits für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl; andererseits kann dieser dabei gleichzeitig helfen, Blutzuckerspitzen zu vermeiden – ein entscheidender Faktor angesichts der wachsenden Zahl an Diabetiker*innen in Indien im Kontext des Double Burden of Malnutrition. Zudem ist die Pflanze – im Gegensatz zu Reis – widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit, benötigt wenig Bewässerung und gedeiht auch auf kargen Böden; allesamt Eigenschaften, welche Ragi auch in Zeiten des Klimawandels besonders relevant machen, jedoch gleichzeitig typische Merkmale eines „Armenessens“ komplettieren.
Ragi ist als Stärkebeilage, anstelle von Reis, in ruralen Regionen Südkarnatakas bis heute fest in den Ernährungsalltag integriert; vornehmlich in Form von Ragi-Mudde, einem festen Kloß aus gekochtem Ragi-Mehl, und Ragi-Rotti, einem dünnes Fladenbrot, oft mit Zwiebeln und Gewürzen verfeinert. Diese Gerichte werden häufig zu typischen südindischen Currys – genannt Saaru oder Huli – serviert. Darüber hinaus spielt Ragi auch bei Festen und in regionalen hinduistischen Praktiken eine wichtige Rolle, wo es zu oder um spezielle Anlässe wie Hochzeiten oder lokalen Feiertagen serviert wird. In ruralen Kontexten kann Ragi damit aufgrund seiner Materialität als Konkretion, sowohl für Alltäglichkeit, als auch für Kontinuität kultureller und religiöser Traditionen gesehen werden.
In urbanen Zentren wie Bangalore war Ragi lange Zeit aufgrund seiner Materialität mit einem sozialen Stigma versehen, worunter es auch heute noch leidet. Es galt und gilt als das Essen der ärmeren Stadtbevölkerung und wurde von der städtischen Mittelschicht weitgehend gemieden. Eine Vorliebe für den zarten Reis und dessen steigendes Vorhandensein verstärkte diese Differenz. Seit einigen Jahren lässt sich jedoch ein grundlegender Wandel beobachten. Die besagten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitsfördernde Materialität von Ragi führen zu einer gesellschaftlichen (Wieder)entdeckung. Angesichts der steigenden Prävalenz von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – vornehmlich in Städten wie Bangalore – wird Ragi zunehmend als gesunde Alternative zu Reis interpretiert und vermarktet. In Cafés, Restaurants und Haushalten der Mittel- und Oberschicht gilt es heute als „Superfood“. Neue Gerichte wie Ragi-Dosa oder Ragi-basierte Kekse und Power-Shakes zeigen, wie sich traditionelle Zutaten, vornehmlich aus ruralen Gegenden, in sogenannte „moderne“ urbane Konsumstile integrieren bzw. übertragen lassen. Auch Lebensmittelindustrien tragen durch Fertigprodukte dazu bei, Ragi für andere Bevölkerungsteile wieder bekannter und leichter zugänglich zu machen.
Diese Neuinterpretationen von Ragis Materialität bedeuten jedoch nicht, dass daran festgemachte soziale Unterschiede am Verschwinden sind. Im Gegenteil: Während Ragi in ruralen Regionen Südkarnatakas weiterhin als eines der Grundnahrungsmittel der tendenziell niedrigeren Einkommensschichten gilt, wird es in den urbanen Räumen nun wieder mehr von der Mittel- und Oberschicht konsumiert – allerdings in anderen Zubereitungsformen und mit abweichenden Motivationen.
Es lässt sich daher eine Ambivalenz feststellen: Ragi verbindet Menschen über das gemeinsame Bedürfnis nach gesunder Nahrung, trennt sie aber zugleich durch soziale Zuschreibungen und geschmackliche Präferenzen.
Diskussion
Es wird deutlich, dass Ragi als eine ambivalente Entität, und in seinen verschiedenen Erscheinungsformen als Lebensmittel bzw. Objekt, das Potential besitzt, die damit interagierenden Menschen zu vereinen und zu trennen. Die Materialität von Ragi nach den Definitionen von Tim Ingold – dessen Anbaubedingungen als Pflanze und physiologischen Eigenschaften in Form von Nahrung – prägten über Jahrhunderte und bis heute, dessen oszillierende Interpretationen als marginalisiertes „Armenessen“ einerseits und als gesundheitsförderndes „Superfood“ andererseits. Um diese Dynamiken zu verstehen, reicht weder eine rein kulturelle noch eine rein ökologische Herangehensweise. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel von Naturen und Kulturen. Ragi kann einerseits als ein widerstandsfähiges Getreide mit hohem Nährwert, andererseits als ein Symbol für soziale Differenzierung gesehen werden.
Ähnlich wie in Sidney Mintz’ Analyse des Zuckers, wird am Beispiel Ragi deutlich, wie historische und sozio-ökonomische Kontexte mit globalen Trends, gesundheitspolitischen Diskursen und lokalen Traditionen zusammenwirken, um Ragi als Pflanze und Lebensmittel immer wieder neu zu interpretieren und definieren. Im Rahmen der NatureCultures-Debatte wird daher deutlich, dass Ragi nicht nur als natürliche Ressource, sondern zugleich als kulturell prägendes Objekt verstanden werden muss.
Fazit
Die Untersuchung von Ragi in Südkarnataka zeigt exemplarisch, wie sich Naturen – in Form von Pflanzen und daraus resultierender Nahrung – und Kulturen – niedergeschlagen als sozio-kulturell spezifischen Zubereitungsformen und Aufnahmen, verbunden mit Zuschreibungen und Differenzierungen – gegenseitig bedingen.
Tendenziell galt und gilt Ragi in ruralen Regionen Südkarnatakas als Grundnahrungsmittel, welches zugleich tief in kulturellen und religiösen Traditionen verankert ist. In urbanen Zentren wie der Megacity Bangalore hingegen, wird Ragi als „Superfood“ neu entdeckt, allerdings primär von der wachsenden Mittelschicht, während tendenziell ärmere Bevölkerungsteile der Stadt Ragi seit jeher als Grundnahrungsmittel nutzen. Deshalb können meine zwei aufgestellten Kategorien auch innerhalb Bangalores selbst existieren, was eine strikte Unterscheidung zwischen Stadt und Land erschwert. Globalisierungs- und Urbanisierungsprozesse schaffen zwar Überschneidungen, doch werden soziale Unterschiede dadurch nicht überwunden.
Meine Masterarbeit leistet damit einen Beitrag zur Kulinarischen Ethnologie, indem sie zeigt, wie die materiellen Eigenschaften eines Nahrungsmittels und seine kulturellen Zuschreibungen ineinandergreifen. Für die Ernährungspolitik ergeben sich daraus wichtige Implikationen. Ragi könnte sowohl zur Bekämpfung von Mangelernährung als auch zur Prävention von Zivilisationskrankheiten eingesetzt werden. Zugleich bleibt die Herausforderung bestehen, eine sozial inklusive Nutzung sicherzustellen, die nicht erneut bestehende Ungleichheiten verstärkt.
Ragi steht damit beispielhaft für den Nexus von Ökologie, Gesundheit, Ökonomie und sozialer Differenzierung – und verweist auf die Notwendigkeit, Nahrung stets als integrales Element von „NatureCultures“ zu begreifen.
Jasmin Lasslop ist Ethnologin mit einem regionalen Schwerpunkt auf Südasien, insbesondere Indien. Sie studierte Ethnologie und Modern Indian Studies an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie absolvierte Auslandssemester an der Savitribai Phule Pune University während ihres Bachelorstudiums sowie an der University of Agricultural Sciences Bangalore während ihres Masterstudiums. Für ihre Masterarbeit „Urban Super Food vs. Rural Staple Food: (Re)discovering Ragi in Bangalore and South Karnataka“ führte sie eine siebenmonatige Feldforschung in und um Bengaluru durch und präsentierte ihre Ergebnisse bereits beim Ethnologischen Sommersymposium im Frobenius-Institut.