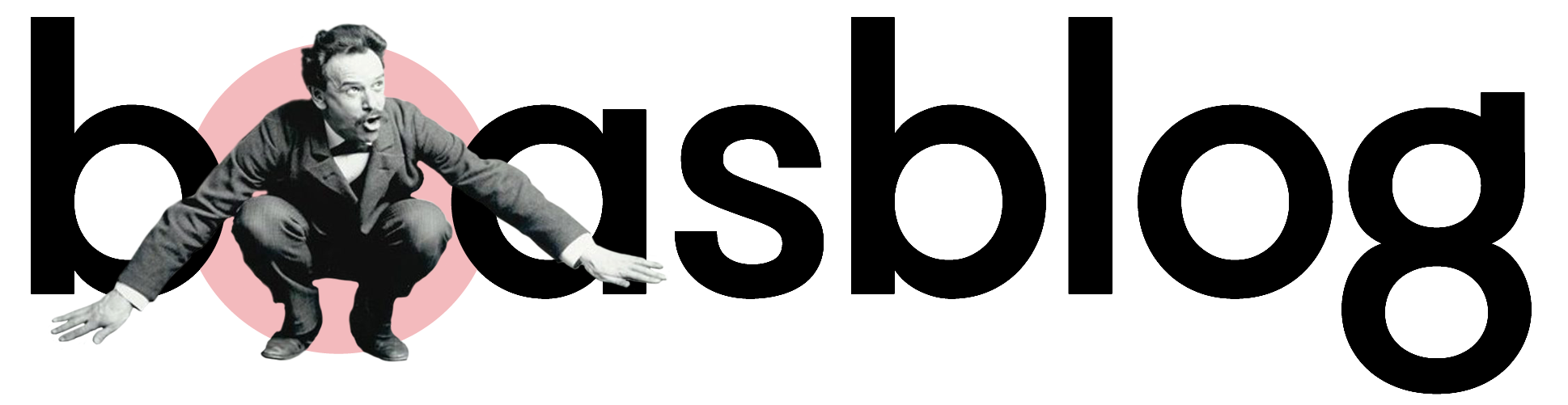Vom “Nachleben” der Daten
Digitale ethnografische Forschungsdaten archivieren – und dann?

Foto: Kathleen Heft, Bildbearbeitung: Lea Farah Heiser, CC BY-SA 4.0.
“Offenheit” von Daten, Information und Wissen ist kein absoluter oder selbstverständlicher Wert. Offenheit ist dauerhaft in der Verhandlung, muss mit anderen Werten und Interessen – etwa Fürsorge, Verantwortung oder Sicherheit – abgewogen werden und wird entsprechend eingeschränkt, durch Datenschutz und Persönlichkeitsrechte zum Beispiel, Wahlrechtsgrundsätze oder das Urheberrecht.
Als wir vor einigen Jahren begonnen haben, uns im Rahmen des Fachinformationsdienstes Sozial- und Kulturanthropologie (FID SKA) mit Forschungsdatenmanagement (FDM) für ethnografische Daten zu beschäftigen, wurde sehr schnell klar, dass mit der Frage, ob und, wenn ja, wie rezente (digitale) ethnografische Feldforschungsdaten für weitere Nutzungen in Forschung und Lehre geteilt werden können oder sollten, auch grundsätzliche „alte“ Fragen der ethnologischen Fächer aktualisiert werden, nach rechtlich und vor allem ethisch angemessenem Umgang mit Material etwa, nach Forscher:innenpositionen oder Verständnissen von Autor:innenschaft und Autorisierung. In Gesprächen mit forschenden Ethnolog:innen führte vor allem die Annahme, dass ethnografisches Material – so hatten es wissenschafts- und förderpolitische Anforderungen scheinbar nahegelegt – künftig wie andere Forschungsdaten auch in großem Umfang frei im Internet zugänglich sein sollte, zunächst zu teils heftiger Kritik.
Zugänglich bedeutet nicht zwangsläufig offen
Mittlerweile ist klar, dass ethnografisches Material – wenn überhaupt – ähnlich wie alle qualitativen Daten in den meisten Fällen nur mit Zugangsbeschränkungen für weitere Nutzungen zur Verfügung gestellt werden kann. Zum Beispiel sind die sogenannten FAIR-Prinzipien im Kontext von Open Science ein breit akzeptiertes Konzept, demzufolge Forschungsdaten zwar findbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und nachnutzbar (re-usable), aber eben nicht zwingend offen im strengen Sinn sein sollen. Auch rücken mit Konzepten wie den CARE Principles for Indigenous Data Governance Aspekte wie Verantwortung und Kontrolle über Daten und damit machtkritische und ethische Dimensionen der Zugänglichkeit von (Forschungs-)Daten in den Mittelpunkt, die – konsequent umgesetzt – Offenheit einschränken können (Carroll et al. 2020, vgl. Imeri, Rizzolli 2022).
Um aber rezente ethnografische Forschungsdaten und Materialien überhaupt zugänglich machen zu können, werden spezialisierte Datenzentren benötigt, die über eine technisch besonders gesicherte Infrastruktur verfügen und zudem an ethnografisches Material angepasste Verfahren der Archivierung und der sogenannten Nachnutzung zur Verfügung stellen können, wie etwa das Forschungsdatenzentrum (FDZ) Qualiservice an der Universität Bremen (Rizzolli, Imeri, Huber 2024).
Generische Repositorien wie Zenodo, RADAR oder universitäre Datenserver hingegen sind vor allem für sensible ethnografische Daten in der Regel nicht geeignet.
Bei Qualiservice kann also digitales ethnografisches Material zugänglich gemacht werden, ohne dass es frei im Netz steht, sondern so, dass es von interessierten Wissenschaftler:innen unter kontrollierten Bedingungen für Forschung und/oder Lehre verwendet werden kann (Rizzolli, Imeri und Huber 2024).
Datenarchivierung und Ethik – ein Spannungsfeld
Aber auch unabhängig von der Frage, was Zugänglichkeit genau bedeutet, sind Ethnolog:innen mit Blick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Material häufig skeptisch, wenn es um die potenzielle Weitergabe ethnografischer Daten geht. Zentral ist etwa die Befürchtung, dass Vertrauensbeziehungen zu Feldpartner:innen gestört werden und sich besonders sensible Felder womöglich komplett verschließen könnten. Auch Schwierigkeiten der Kontextualisierung werden hier thematisiert, etwa mit Blick auf die verkörperten Dimensionen von Felderfahrung, die sich nicht datenförmig im Material abbilden, und allgemeiner die enge Bindung des Materials an die forschende Person, insbesondere wenn es um die Weitergabe von Feldnotizen oder Feldtagebüchern geht. Weil ethnografische Forschung in der Regel in engem Austausch zwischen Forschenden und ihren Gesprächspartner:innen stattfindet, stellt sich zudem die Frage, wem diese Materialien gehören bzw. inwieweit es ethisch erforderlich und praktisch umsetzbar wäre, Forschungsteilnehmer:innen in Archivierungsprozesse einzubinden (vgl. z.B. Behrends et al. 2022, DGEKW 2023, DGSKA 2019).
Vom Wert ethnografischer Daten
Gleichzeitig sind ethnografische Materialien in der Regel unikal, sie können dokumentarischen Charakter haben – und damit einen Wert, der womöglich erst nach und nach erkennbar wird. Beispiele aus den National Anthropological Archives der Smithsonian Institution zeigen, dass es dabei nicht nur um wissenschaftliche Forschung geht, sondern auch um die Nutzung älteren ethnografischen Materials durch die Nachkommen der dort beschriebenen Gruppen und Communitys selbst, etwa in der Beschäftigung mit dem eigenen kulturellen Erbe oder in Landkonflikten (Leopold 2008). Am Nachlass des Ethnologen Werner Finke, der am Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien betreut und auch digitalisiert wird, wiederum zeigt sich, dass die Arbeit mit archiviertem Material neue Formen der Kollaboration auch im Sinne einer Public Anthropology (Binder, Dilger, Kirsch 2025) ermöglicht. Hier ist in den letzten Jahren umfangreich etwa mit kunstbasierten Ansätzen und partizipativen Methoden zu Identitätskonstruktionen und historischen Narrativen kurdischen Lebens in der Türkei geforscht worden (vgl. die Beiträge in Six-Hohenbalken et al. 2025). Die Frage, ob ethisch verantwortlicher Umgang mit Forschungsdaten in manchen Fällen nicht gerade bedeuten kann, Material dauerhaft zu erhalten und zugänglich zu machen, ist gleichwohl nicht immer leicht zu beantworten (Behrends et al. 2022). Während der Schutz von Gesprächspartner:innen nahelegen kann, Material umfangreich zu anonymisieren und nicht zu archivieren, kann zum Beispiel die Achtung möglicher künftiger Interessen der Nachkommen dieser Personen den Erhalt der Erkennbarkeit sowie langfristige Archivierung und Zugänglichkeit nahelegen (Zeitlyn 2022). Die Archivierung des Datensatzes „Mangroves and Meaning-Making: A mutual relationship over time? Ethnographic data“ (Hornidge et al. 2021) bei Qualiservice zum Beispiel war maßgeblich durch forschungsethische Überlegungen motiviert. Die Datengeberin Anne-Katrin Broocks (2021: 13) schreibt:
„The data collected in this study can be understood as an oral, non-hegemonic discourse which has not been recorded in a written way yet. Archiving them aims to provide a greater access to this marginalized discourse.“
Auch die Archivierung kann in diesem Sinne als ein Beitrag dazu verstanden werden, die Perspektiven von Angehörigen marginalisierter Gruppen langfristig im wissenschaftlichen Diskurs sichtbar zu machen.
Nachnutzung: Hat das schon jemand gemacht?
Insgesamt aber lässt sich das Potenzial für weitere Nutzungen kaum vollständig antizipieren – nicht zuletzt, weil umfangreichere Arbeiten auf der Grundlage einer Sichtung und Nachnutzung archivierter Forschungsdaten unter ähnlichen oder anderen Fragestellungen zumindest in den ethnologischen Fächern bisher die Ausnahme sind und weil – sieht man vielleicht von (digitalisiertem) Material in Vor- und Nachlässen ab, wie sie etwa das Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung in Frankfurt/M. seit vielen Jahren archiviert – rezente Feldforschungsdaten erst nach und nach in Datenzentren zur Verfügung stehen.
Nichtsdestotrotz gibt es Arbeitsweisen, die dezidiert auf die gemeinsame Nutzung von Daten und Material setzen, wie etwa Langzeitforschungen, die nach einiger Zeit in die Hände anderer Forscher:innen gelegt werden. Lisa Cliggett hat ihre Erfahrungen mit einer solchen Übernahme von Forschungsfeld und Material eindrücklich beschrieben. Im Rahmen der Langzeitstudie „Gwembe Tonga Research Project“ am Sambesi übernahm sie ein umfangreiches Konvolut analoger Materialien – darunter Notizen, Fotos, Tagebücher – aus mehr als 40 Jahren Forschung ihrer Vorgänger:innen und führte diese mit ihren eigenen ethnografischen Daten zusammen. Ziel war die Entwicklung eines durchsuchbaren digitalen Archivs, um das Material auch öffentlich zugänglich zu machen (Cliggett 2016). In zwei Arbeiten aus der Europäischen Ethnologie sind wiederum Interviews von Dritten unter methodischen Gesichtspunkten neu bearbeitet worden (Oldörp 2018, Simon 2015, vgl. Imeri 2018). Gerade Interviews sind in benachbarten Disziplinen aber auch inhaltlich schon mit vollständig anderen als den ursprünglichen Fragestellungen neu analysiert worden (z.B. Hodenberg 2018). Zu diskutieren wäre darüber hinaus zum Beispiel, ob die Nachnutzung von Material, das sich auf „überforschte“ Felder oder Gruppen bezieht, auch in den Ethnologien eine Rolle spielen könnte (Hollstein, Strübing 2018: 2). Die Frage wiederum, ob rezente Forschungsdaten zu historischem Material werden, solange die Erhebungskontexte noch gegenwärtig sind oder wann das geschieht (Imeri 2018) – und was das für die Zugänglichkeit aber auch für das Nachnutzungspotenzial bedeuten kann –, ist nicht nur für Ethnolog:innen, sondern auch für Forscher:innen aus anderen Disziplinen mit Interesse an ethnografischem Material relevant. Denkbar wäre auch, dass nicht die „eigentlichen“ Forschungsdaten, sondern Kontextmaterialien wie Leitfäden, Anonymisierungskonzepte oder Informed Consent Vorlagen zur Planung eigener Forschungsvorhaben in ähnlichen Feldern herangezogen werden. Und nicht zuletzt: Welche Rolle archivierte Materialien spielen können, um in der Lehre Methodenkompetenz zu schulen und epistemologische Fragestellungen zu diskutieren, ist bisher fachlich bestenfalls andiskutiert und kaum ausprobiert.
Ethnografische Materialien bei Qualiservice archivieren
Aufgrund ihrer Sensibilität und Kontextdichte können ethnografische Daten also in der Regel nicht öffentlich frei zugänglich gemacht werden. Das FDZ Qualiservice bietet hierfür geeignete Verfahren: Zentral ist, dass zwar Metadaten, die das archivierte Material beschreiben, sowie ein sogenannter Studienreport, der zusätzliche Informationen zum institutionellen Rahmen der Forschung, zu den verwendeten Methoden und den Kontexten der Materialproduktion und Ähnliches enthält, publiziert werden. Die „eigentlichen“ ethnografischen Forschungsmaterialien sind hingegen nicht frei im Netz verfügbar. Sie können ausschließlich erst nach Kontaktaufnahme mit Qualiservice und zu den vorab mit den Datengebenden – aus deren Forschungen das Material stammt – vereinbarten Bedingungen von qualifizierten Forscher:innen für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Ein zentrales Merkmal der Archivierung bei Qualiservice ist die „kooperative Datenvorbereitung“ (Mozygemba, Kretzer 2020): Forschende werden idealerweise bereits bei der Projektplanung und während des gesamten Forschungsprozesses beratend begleitet – etwa in Fragen des Datenschutzes und der Forschungsethik sowie bei der Kontextualisierung und Anonymisierung / Pseudonymisierung von Forschungsmaterialien. Die während dieses Prozesses getroffenen Entscheidungen haben wiederum Auswirkungen auf mögliche Nachnutzungsszenarien. Kooperativ heißt deshalb auch, dass Forschende nicht nur in hohem Maße darüber bestimmen können, welche Forschungsmaterialien und Kontextinformationen archiviert werden. Weil sie ihr Material und die Umstände und Kontexte ihrer Forschung am besten kennen, entscheiden sie letztlich selbst bzw. im Austausch mit ihren Feldpartner:innen, wann bzw. unter welchen Bedingungen welches Material nachgenutzt werden kann. Möglich sind zum Beispiel Sperrfristen (zeitliches Embargo) oder der Ausschluss bestimmter Nutzungszwecke wie etwa die Verwendung des Materials in der Lehre. Bei besonders sensiblen Daten kann festgelegt werden, dass diese nur vor Ort in Bremen eingesehen werden dürfen.
Kontexte der Materialentstehung erhalten
Weil vertiefte Einblicke in die Kontexte der Datenentstehung für das Verständnis und die Deutung des Materials unentbehrlich ist, stellt Qualiservice verschiedene Formate der Kontextualisierung bereit. Dazu gehören z.B. der schon erwähnte Studienreport sowie die ausführlichen Metadaten, die dafür sorgen, dass archiviertes Material in übergreifenden Datenportalen wie QualidataNet oder auch im Fachportal EVIFA gesucht und gefunden werden kann. Weil es im Rahmen ethnografischer Forschung nicht immer möglich ist, alle Informationen, die für das Verständnis des Materials hilfreich oder notwendig sind, im Studienreport offenzulegen, wurde im Rahmen der Kooperation mit dem FID SKA der sogenannte Feldreport als fachspezifisches Format der Dokumentation bei Qualiservice eingeführt (vgl. Rizzolli, Imeri, Huber 2024: 14-15). Der Feldreport kann insbesondere zur Weitergabe zusätzlicher Hinweise bzw. sensibler Informationen wie z.B. zur Beziehungsgestaltung, zu Schwierigkeiten im Feld, Lücken im Material und Ähnlichem genutzt werden. Wie das „eigentliche“ Forschungsmaterial ist auch der Feldreport nicht frei im Internet zugänglich.
Diese unterschiedlichen Formate der Dokumentation sollen helfen, die Lücke zwischen der primären Feldforschung und dem „not having ‚been there‘“ (Heaton 2004: 60ff) möglicher Sekundärnutzungen zu überbrücken. Gleichwohl wird sich archiviertes Material nicht umstandslos wie selbst erzeugte Forschungsdaten behandeln lassen. Womöglich geht es auch in erster Linie nicht unbedingt darum, eine Forschung ausschließlich mit Sekundärmaterial durchzuführen – auch wenn noch nicht klar ist, inwieweit zum Beispiel die Bearbeitung auch größerer Datenmengen, die dann auch aus Datenarchiven stammen könnten, mit digitalen bzw. computationellen Verfahren Eingang in das Methodenspektrum der ethnologischen Forschung finden werden (vgl. Franken 2023). Vielmehr könnten archivierte Feldforschungsdaten Teil des Materialmixes werden, der ohnehin in vielen Feldforschungen erzeugt wird. Unabhängig davon wird sich eine erneuerte digitale Quellenkritik (vgl. z.B. Deicke et al. 2024) auch auf dieses Material erstrecken müssen.
Nachnutzung: noch selten, aber mit Potenzial
Auch wenn die Nachnutzung ethnografischer Datensätze bei Qualiservice bislang noch aussteht – aufgrund des aktuell noch überschaubaren Datenpools oder auch wegen Sperrfristen für bestimmte Materialien –, sehen die Datengebenden Potenziale für mögliche Nachnutzungen, die im jeweiligen Studienreport notiert worden sind, teils weit über die eigene Disziplin hinaus: Das ethnografische Datenmaterial aus dem Verbundprojekt „Medien und wissenschaftliche Kommunikation“ (Broer 2021) zum Beispiel umfasst Transkripte, Feldnotizen und Chatprotokolle, die im Rahmen einer Redaktionsethnografie am Science Media Center Germany entstanden sind. Aus Sicht der Datengeberin bietet das Material insbesondere für fachverwandte Bereiche wie die Wissenschaftskommunikationsforschung, die Journalismusforschung und die Organisationssoziologie vielfältige Nachnutzungspotenziale. Aufgrund des spezifischen Zeitpunkts der Datenerhebung während der Corona-Pandemie kann das Material zudem als Momentaufnahme für weitere bzw. vergleichende Forschung interessant sein oder in Zukunft werden. Darüber hinaus eignet sich das Material auch für die Methodenforschung, etwa zu Fragen hybrider Ethnografie (Broer 2022). Das Filmmaterial wiederum, das der Ethnologe Martin Gruber zu Mensch-Bienen-Beziehungen in Kamerun produziert hat, weist aufgrund der ethnografischen Informationsdichte und der interdisziplinären Ausrichtung des Projekts Anknüpfungspunkte für verschiedene Disziplinen auf, unter anderem der Ethnologie, Biologie, Klima- Umwelt- und Biodiversitätsforschung. Das mehrsprachige Material wurde in Zusammenarbeit mit einem Bienenbiologen aus Kamerun annotiert, um eine Nachnutzung über die ethnologischen Fächer hinaus zu fördern (Gruber 2024; Gruber, Rizzolli 2025).
Ob, wann und in welchen Nachnutzungsszenarien ethnografische Materialien tatsächlich nachgenutzt werden, ist derzeit noch unklar. Umso reizvoller ist es jedoch, über mögliche Zukünfte nachzudenken und Nutzungsszenarien zu imaginieren – ein Thema, das wir bereits jetzt aufgreifen möchten, um Diskussionen innerhalb der Fachcommunity anzuregen und weiterzuführen.
Literatur
Behrends, Andrea; Knecht, Michi; Liebelt, Claudia et al. (2022): Zur Teilbarkeit ethnographischer Forschungsdaten. Oder: Wie viel Privatheit braucht ethnographische Forschung? Ein Gedankenaustausch. SFB 1171 Affective Societies Working Papers 1. Berlin. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-35157.2.
Binder, Beate; Dilger, Hansjörg; Kirsch, Thomas G. (2025): Kollaborationen – Einleitung. In: Dilger, Hansjörg; Welz, Gisela; Binder, Beate et al. (Hg.): Public Anthropology. Wissenspraktiken und gesellschaftliche Interventionen der ethnologischen Fächer, 147-158. Frankfurt/New York: Campus Verlag. https://doi.org/10.12907/978-3-593-45943-1.
Broer, Irene (2021): Medien und wissenschaftliche Kommunikation: Redaktionelle Prozesse der Vermittlung wissenschaftlicher Expertise am Science Media Center Germany. Ethnographische Forschungsdaten. Dataset. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.938536.
Broer, Irene (2022): Medien und wissenschaftliche Kommunikation: Redaktionelle Prozesse der Vermittlung wissenschaftlicher Expertise am Science Media Center Germany. Studienreport. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.26092/elib/1483.
Broocks, Anne-Katrin (2021): Mangroves and Meaning-Making: A mutual relationship over time? Transect Walks transcripts. Dataset. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.930180.
Carroll, Stephanie Russo; Garba, Ibrahim; Figueroa-Rodríguez, Oscar L. et al. (2020): The CARE Principles for Indigenous Data Governance, in: Data Science Journal 19(43), 1-12. https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043.
Cliggett, Lisa (2016): Preservation, Sharing, and Technological Challenges of Longitudinal Research in the Digital Age. In: Sanjek, Roger; Tratner Susan W. (Hg.): eFieldnotes. The Makings of Anthropology in the Digital World. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 231-250.
Deicke, Aline; Geiger, Jonathan D.; Lemaire, Marina; Schmunk, Stefan (2024): 1. Einleitung: Was ist Digitale Quellenkritik? In: Dies (Hg.): Living Handbook „Digitale Quellenkritik“. Version 1.1. https://doi.org/10.5281/zenodo.12650164.
Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie (DGSKA) (2019): Positionspapier zum Umgang mit ethnologischen Forschungsdaten. https://www.dgska.de/wp-content/uploads/2019/11/Positionspapier_Bearbeitet-fu%CC%88r-MV_24.09.2019.pdf [Zugriff am 24.09.2025].
Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) (2023): DGEKW-Positionspapier zu Forschungsdatenmanagement. https://doi.org/10.18452/27741.
Franken, Lina (2023): Digitale Methoden für qualitative Forschung. Computationelle Daten und Verfahren. Münster: Waxmann. https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838559476.
Gruber, Martin (2024): Traditional Beekeeping and Honey Hunting: Audiovisual Material, Video Footage. Dataset. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.963249.
Gruber, Martin; Rizzolli, Michaela (2025): Audiovisuelle Forschungsdaten und ihre Kontexte teilen. Archivierung und Nachnutzung von Daten aus der ethnografischen Filmforschung. In: Wilke, René; Knoblauch, Hubert (Hg.): Videographie und Videoanalyse. Beiträge zur Erhebung, Analyse und Nutzung von Videodaten in der Qualitativen Forschung, 452-469. Berlin: Beltz Juventa. https://doi.org/10.3262/978-3-7799-8525-9.
Heaton, Janet. 2004. Reworking Qualitative Data. London: Sage.
Hodenberg, Christina von (2018): Das andere Achtundsechzig. Gesellschaftsgeschichte einer Revolte. München: C.H.Beck.
Hollstein, Betina; Strübing, Jörg (2018): Archivierung und Zugang zu Qualitativen Daten. RatSWD Working Papers 267. https://doi.org/10.17620/02671.35.
Hornidge, Anna-Katharina; Barragán-Paladines, María José et al. (Hg.) (2021): Mangroves and Meaning-Making: A mutual relationship over time? Ethnographic Data. Dataset. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.929747.
Imeri, Sabine (2018): Ordnen, archivieren, teilen. Forschungsdaten in den ethnologischen Fächern. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, LXXII/121(2), 213-243. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:4-5937.
Imeri, Sabine; Rizzolli, Michaela (2022): CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten? O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 9(2), 1-14. https://doi.org/10.5282/o-bib/5815.
Leopold, Robert (2008): The Second Life of Ethnographic Fieldnotes. In: Ateliers d‘Anthropologie, 32. https://doi.org/10.4000/ateliers.3132.
Mozygemba, Kati und Susanne Kretzer (2020): Datenvielfalt im Data-Sharing – eine kooperative Aufgabe von Forschenden und Forschungsdatenzentrum (preprint). Qualiservice Working Papers 3. Bremen: FDZ Qualiservice. http://dx.doi.org/10.26092/elib/345.
Oldörp, Christine (2018): Verschriftlichungen? Zur Technizität und Medialität des Sprechens im qualitativen Interview. Zürich: Chronos Verlag.
Rizzolli, Michaela, Sabine Imeri und Elisabeth Huber (2024): Ethnografische Forschungsmaterialien zur Archivierung und Nachnutzung vorbereiten und dokumentieren – ein Überblick für Forschende. Qualiservice Working Papers 6. Bremen: FDZ Qualiservice. https://doi.org/10.26092/elib/2723.
Simon, Michael (2015): Ethnologische Anmerkungen zu Bernd Riekens „Gesprächen mit Einheimischen“ in Galtür. In: Rieken, Bernd (Hg.): Wie bewältigt man das Unfassbare? Interdisziplinäre Zugänge am Beispiel der Lawinenkatastrophe von Galtür, 93-105. Münster: Waxmann Verlag.
Six-Hohenbalken, Maria; Emir, Mehmed; Kolm, Eva et al. (2025): Viyano ‒ A Passion for Kurds and Mountain Life. The Werner Finke Collection. Veröffentlichungen zur Sozialanthropologie, 34. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. https://doi.org/10.1553/978OEAW96624.
Zeitlyn, David (2022): Archiving ethnography? The impossibility and the necessity. In: Ateliers d’anthropologie 51. https://doi.org//10.4000/ateliers.16318.
Lizenzen
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 lizenziert. Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung der Urheber:innen die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Die Grafik ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 lizenziert. Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung der Urheber:innen die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. Wenn Sie das Material bearbeiten, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sabine Imeri hat Europäische Ethnologie und Neuere/Neueste Geschichte studiert und am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie (FID SKA) an der Universitätsbibliothek der HU Berlin, hat dort mit Blick auf die Archivierung und Nachnutzung ethnografischer Daten Bedarfserhebungen durchgeführt und Anforderungsprofile entwickelt und unterstützt die Entwicklung entsprechender Workflows beim Forschungsdatenzentrum Qualiservice an der Universität Bremen. https://orcid.org/0000-0002-8844-4014
Michaela Rizzolli hat Europäische Ethnologie und Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Medienpädagogik und Kommunikationskultur an der Universität Innsbruck studiert und 2016 dort promoviert. Erste Erfahrungen im Bereich Forschungsdatenmanagement sammelte sie am SFB „Affective Societies“ an der Freien Universität in Berlin, wo sie im Rahmen eines Informationsinfrastrukturprojekts zu Datenpraktiken qualitativ Forschender forschte sowie den Verbund beim Datenmanagement unterstützte. Seit Mai 2022 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Qualiservice beschäftigt und befasst sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung passender Workflows für die Archivierung von Forschungsdaten aus den ethnologischen Fächern. https://orcid.org/0000-0001-8154-6563