Schreiben, Übersetzen, Kochen
Die "Filmkritik"-Mitarbeiterin Melanie Walz im Gespräch mit Philipp Goll
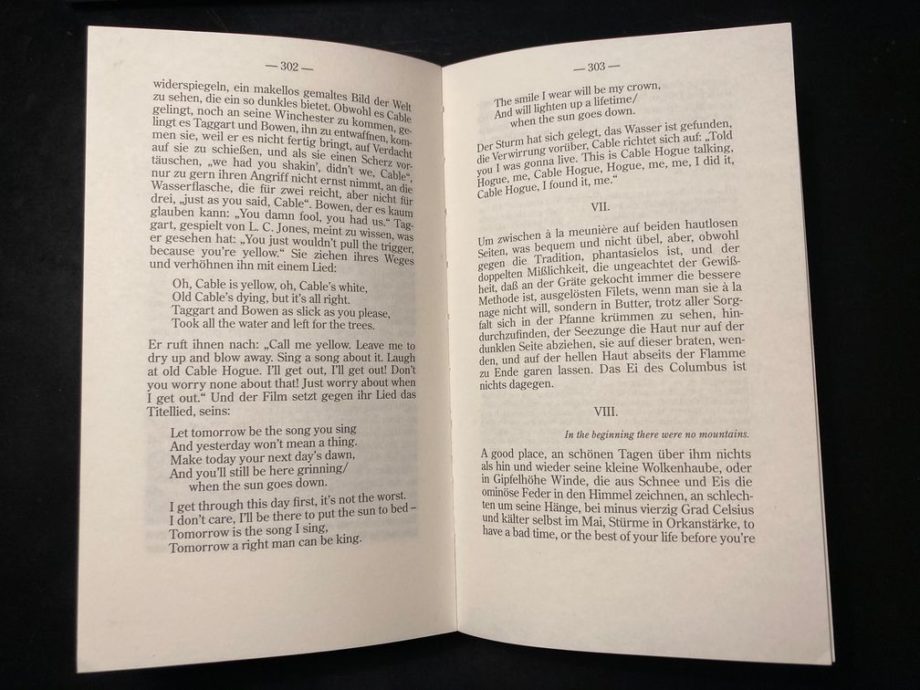
Aus „French Fried Potatoes“, in: Die Republik, hg. von Petra und Uwe Nettelbeck, Nr. 98–108, 12. Dezember 1999, S. 65–642.
Im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit zu Petra und Uwe Nettelbecks Zeitschrift „Die Republik“ (1976–2008) interviewte ich auch Mitarbeiter*innen der Zeitschrift „Filmkritik“. Die Lektüre und Erforschung der Zeitschrift, die 1957 gegründet wurde und sich nach und nach zur wichtigsten Filmzeitschrift der BRD entwickelte, wuchs sich zu einem umfassenden Nebenprojekt meiner Diss aus. Das lag nicht nur daran, dass Uwe Nettelbeck Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre Autor der Filmzeitschrift war. Meine Faszination für diese Zeitschrift geht maßgeblich auch auf die Essayistin Frieda Grafe (1934–2002) zurück, deren Texte sowohl in der „Filmkritik“ als auch in Nettelbecks „Republik“ erschienen. Im Juni 2018 traf ich die ehemalige „Filmkritik“-Mitarbeiterin und Übersetzerin Melanie Walz und sprach mit ihr über die Arbeit in der „Filmkritik“ und Frieda Grafe, übers Schreiben, Übersetzen und Kochen.
Philipp Goll: Ich frage mich, warum ging die Filmkritik, eine der wichtigsten Filmzeitschriften der Nachkriegszeit in der BRD im Jahr, eigentlich 1984 ein?
Melanie Walz: Ich habe zwei Thesen. Bei uns war das Problem, dass die Filmkritik sich zu einer Veranstaltung entwickelt hat, bei der man eigentlich nur noch Themenhefte gemacht hat. Die normale Filmkritik wurde am Ende abgehandelt in so kleinen Artikelchen. Aber der Hauptteil war immer themenorientiert: zu John Ford, zwei Hefte über Irving Lerner, zu was auch immer. Auch über sehr abseitige Sachen. Sehr interessant. Es wurde halt viel geforscht. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber die Leute wollten dann doch lieber hören, ob der neue Spielberg sich lohnt, ob man da reingehen soll, und sie wollen nicht wissen, was Ford sich gedacht hat bei dem und dem Film. Und über Straub wollten sie schon gar nichts wissen. Kann man ja manchmal auch verstehen.
Dadurch ist natürlich der Abonnentenstand rasend auf jene treue Kunden geschrumpft, die immer noch dazuhielten. Und die Bibliotheken. Aber wir konnten von dem Geld dann nicht mehr leben. Außerdem waren wir ja immer zu spät mit der Preiserhöhung dran. Und dann war das auch immer zu zaghaft. Das Problem war, wir hatten einen Geschäftsführer, Wolfgang Gollus, ein überzeugter SPD-Mann, den hat der Peter Nau aus Studientagen gekannt. Der Wolfgang kam aus einer Buchhandlung, der war Buchhändler, und er träume immer davon, dass die Filmkritik eine Zeitschrift für alle sein sollte. Das war natürlich Quatsch, denn sie war ja immer elitär. Wolfgang hat sich jedenfalls immer allen Bestrebungen wiedersetzt, die Preise zu erhöhen. In den späten 1970ern und frühen 1980ern war das dann nur noch eine finanzielle Katastrophe.
Und wie lautet Ihre zweite These dazu, warum die Filmkritik eingestellt werden musste?
Also das andere Problem war, es wuchs nichts nach. Es gab Ende der 1960er die Palastrevolte gegen Patalas und Konsorten. Das war auch sicher richtig. Diese Art von Filmkritik, die sie entwickelt hatten, das war ja das bessere Feuilleton, das auch wichtig war in der Zeit, aber diese Form hatte sich vielleicht langsam doch ein bisschen überlebt. Und die junge Garde hat dann auf nicht sehr freundliche Weise die Alten mehr oder weniger rausgedrängt. Ende der 1970er, Anfang der 1980er kamen dann wirklich sehr viele interessante und auch kluge junge Leute, die mitmachen wollten, aber die versuchten dann immer so schreiben wie der Hartmut Bitomsky, oder wie der Harun Farocki. Und das geht halt nicht. Die sollen schreiben, wie sie selbst schreiben! Also die waren so am Schürzenzipfel unterwegs, das war einfach fürchterlich.
Und diese Text waren dann epigonal?
Das war epigonal und einfach unfertig. Also, es ist komisch. Die wollte alle gern, aber was gefehlt hat, war der Impetus: „Ich zeig den Alten jetzt mal, dass sie nicht mehr gebraucht werden!“ Das gab’s nicht.
Und Ihre These wäre jetzt, wenn es das gegeben hätte, dann hätte die Filmkritik weiter existiert?
Vielleicht. Ich meine, die Finanzprobleme sind die eine Sache, aber dass da tote Hose bei den Mitarbeitern ist, ist noch viel schlimmer. Der Volker Pantenburg hat nochmal viel später was probiert, der hat ja dann irgendwie die Neue Filmkritik erfunden.
Ja, das war die new filmkritik, die u.a. von Pantenburg gemacht wurde. Die war online.
Da hat die Susanne Röckel auch ein paar Mal mitgearbeitet. Aber vielleicht kann man bestimmte Sachen auch nicht am Leben erhalten, wenn die Zeit dafür nicht mehr ist.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass sich die historischen Bedingungen geändert haben, dann würde ich gern fragen, was Kino damals überhaupt bedeutete. Dass die Filmkritik einging, liegt vielleicht auch daran, dass das Kino eine spezielle Kunstform war, die auch zeitlich gebunden war.
In den frühen Zeiten der Filmkritik war natürlich das aktuelle Kino total wichtig, weil das war ja innovativ und interessant, Antonioni und Pipapo. Danach, in der zweiten Brigade, hat man sich dann auf historische Sachen besonnen, so ähnlich wie in den Cahiers, da hat man Sachen entdeckt, die vorher verpönt waren: Alfred Hitchcock, Howard Hawks, John Ford, ich meine, Ford galt ja als schlimmer Faschist, weil er auch einen faschistischen Hauptdarsteller hatte. Zur Zeit von Enno Patalas und Frieda Grafe hätte man die Nase gerümpft bei solchen Sachen, das war ja das hinterletzte.
Wie kamen Sie eigentlich zu Ihrer ersten Filmkritik, also zum ersten Heft?
Als ich zu Beginn meines Studiums in eine Wohngemeinschaft eingezogen bin, wohnte da auch der Eberhard Ludwig, mein heutiger Mann, und der war ja der Hersteller und heimlicher Chef der Filmkritik.
Seit wann war er bei der Filmkritik?
Der ist 1970 in die Filmkritik Kooperative eingetreten, glaube ich.
Und was bedeutet „heimlicher Chef“?
Er hat das Layout gemacht und er konnte sagen: „Ja, also, der Artikel hat leider nicht mehr reingepasst, das ging jetzt vom Layout nicht“.
Vom Filmkritik-Mitarbeiter Jürgen Ebert habe ich erfahren, dass, als die Redaktion 1969 die Filmkritiker-Kooperative gegründet hat, jedes Mitglied schreiben durfte, was es wollte. Das wurde vom Redaktionsstatut so geregelt. Und als Bitomsky und Farocki die Filmkritik Mitte der 1970er übernommen haben, da wurden dann Texte auch mal abgelehnt?
Also das gab’s schon, dass Bitomsky, der war ja da sehr unverblümt, gesagt hat: „So’n Scheiß habe ich ja noch nie gelesen“. Dann hat der andere seinen Text natürlich freiwillig zurückgezogen. Und in den anderen Fällen hat der Eberhard das dann diskret gesteuert, in dem er gesagt hat, da sei einfach kein Platz mehr im Heft. Aber man hat auch Texte abgedruckt, mit denen man nicht so einverstanden war.
Sie selbst kamen dann Ende der 1970er selbst zur Filmkritik.
Ja. Aber ich war ja nur die Mamsell vom Büro (lacht). Ich habe vorher im Verlag gearbeitet und davor in einer Strickfabrik in der Lohnbuchhaltung, und Kundenbuchhaltung gelernt, was sehr nützlich war für die Filmkritik. Und unser Geschäftsführer musste dann aufhören, weil er nicht mehr zu Potte kam mit den Problemen, dass das mit dem Geld nicht geklappt hat, und dass dann überhaupt nichts geklappt hat. Sie brauchten einen Ersatz. Und dann habe ich gesagt, mit meinen Studentenerfahrungen kann ich den Job machen. Ich wollte aber nicht als Geschäftsführer fungieren, sondern als Sekretärin. Dann kann man nämlich sagen, die Geschäftsführung liegt in den Händen des Vorstands, bei Bitomsky, Ludwig und Farocki, und wenn ich ans Telefon gehe, sag ich:e „Grüß Gott, ich bin nur das Fräulein vom Amt, was kann ich für Sie tun?“ (lacht) Und ich habe ja auch nichts anderes gemacht, Buchhaltung, die Hefte verschicken, solche Sachen.
Als sie kamen, gab es ja keine anderen weiblichen Mitarbeiter.
Ne, die einzige war die Susanne Röckel. Frieda Grafe war ja Ende der 1960er, Anfang der 1970er die letzte gewesen. Dann war Ende mit Frauen. Und Ende der 1970er, als ich ins Sekretariat ging, kam auch die Susanne als Autorin dazu. Bei unserem sogenannten Nachwuchs waren aber dann ein paar Frauen dabei.
Kürzlich ist Inge Classen verstorben, sie gehörte ja auch dazu.
Ach!
Ich habe sie leider nie getroffen. Ich wollte immer mit ihr sprechen, doch dann stand kürzlich eine kleine Todesanzeige in der FAZ.
Es gab noch die zwei Lange-Schwestern, Brigitta und Marion. Der Filmkritik-Mitarbeiter Jörg Becker ist heute mit der einen Lange-Schwester verheiratet. Und die andere Lange-Schwester war damals die Geliebte von Filmkritik-Mitarbeiter Peter Nau. Und dann gab es noch die Ingemo Engström.
Woran lag es, dass es so wenige Mitarbeiterinnen gab?
Das liegt daran, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist. Auch in der Kultur. Das ist jetzt nichts Filmkritik-spezifisches. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Frauen, die sich für Film interessiert haben, jetzt nicht unbedingt über Film reflektiert haben und schreiben wollten, sondern dann selber Filme machten, ich denke da an Chantal Ackerman et cetera pp. Die wollten halt nicht schreiben, die wollten ihre Projekte realisieren. Ingemo war ja auch eher daran interessiert, Hefte über ihre eigenen Filme zu machen. Eine gute Freundin von Frieda Grafe war die Agnès Varda. Die ist auch noch fit mit ihren 92 Jahren. Wenn sie Kontakt aufzunehmen versuchen, die wäre sicher gesprächsbereit. Und die kannte die Frieda schon seit ewigen Zeiten, und die wüsste sicher viel.
Wann haben Sie eigentlich Frieda Grafe kennengelernt?
Ich habe Frieda kennengelernt als sie uns in den frühen 1980ern ein paarmal im Büro besucht hat, wo sie sich Jean-Luc Godards France/tour/détour/deux/enfants (1978) auf dem Videorecorder angeschaut hat. Und nachdem wir uns da kennengelernt haben, habe ich sie immer wieder zuhause besucht. Und wir haben uns dann immer über Gott und die Welt unterhalten. Meistens nicht über Film. Eher über Marmeladenrezepte (lacht).
Das finde ich jetzt interessant.
Als ich später im Verlag gearbeitet habe, hat Frieda für mich auch ein Buch übersetzt. Das Alice B. Toklas Kochbuch (1994). Da sind zwar viele Kochrezepte drin, aber Toklas erzählt eigentlich ihre Lebensgeschichte mit Gertrude Stein in Frankreich. Das ist also ihre Biografie. Und das war ein Buch, das Frieda immer sehr geschätzt hat. Und sie hat es dann sogar geschafft, den Wolfram Siebeck dazu zu bringen, dass er ein Nachwort schreibt, was ja immer ein Verkaufsargument ist. Aber der Verleger hat gesagt: „Ne“. Er meinte: „Wissen Sie, Frau Walz, das Buch hat nur 5000 DM Rechte gekostet.“ Was nichts kostet, ist nichts wert. Und dann hat er es so lang auf Halde liegen lassen bis die Agentur gesagt hat, okay, wir haben jetzt einen neuen Interessenten, dann kriegt der es. Daraus wurde dann ein hässliches Coffeetable, mit Paris-Fotos, saublöd, dafür ist es nicht gemacht. Aber das Schöne daran war, dass Frieda und Enno nochmal Geld gesehen haben, weil ich dann zum neuen Verleger gesagt habe, es wäre schon nett, wenn er denen zumindest nochmal die Hälfte vom Übersetzerhonorar zahlen würde für die neue Veröffentlichung.
Wie würden Sie das Schreiben Grafes beschreiben?
Sie denkt sehr über den Stil nach und über die Ordnung der Wörter. Sie ist sehr akribisch. Sie war jedenfalls sehr sprachsensibel. Sie gehört nicht zu denen die sagen, ich weiß nicht, was das heißt, dann schreibe ich jetzt einfach irgendwas hier hin. Sie geht dann sehr in die Tiefe. Sehr gründlich. Sie hat mir mal erzählt, dass sie gebürtige Westfälin ist, und das erklärt natürlich auch viel über ihren Charakter. Die Menschen dort sind ja sehr nachdenklich, gehen sehr in sich, sind jetzt nicht unbedingt Bruder Lustig. Also sie konnte fröhlich sein, aber sie war eben nicht so ein Scherzkeks.
Keine Rheinländerin also.
Ne, das Gegenteil. Und sie hat immer auch die westfälische Küche geliebt, die ja sehr, sehr schwer ist.
Ich wundere mich immer wieder darüber, warum Schreiben über Film und Schreiben übers Kochen bei Frieda Grafe so eng zusammenhängen.
Ja, komisch, gell?
Das ist bei vielen so, die sich schreibend mit Kino befassen. Uwe Nettelbeck ist auch so ein Fall, der hat auch total tolle Texte übers Kochen geschrieben. Und Sie selbst gehören ja auch in diese Reihe. Sie haben ja das Buch Lachen à la carte (1983) herausgegeben.
Ach ja, das kennen Sie? (lacht) Da hatte ich ’ne tolle Rezension im Feinschmecker, da hieß es nämlich, das sei die erste witzige Anekdotensammlung.
Übers Kochen?
Ne, überhaupt (lacht). Sonst sind es ja immer Ärzteanekdoten, Politikeranekdoten, Juristenanekdoten, bei denen man sagt, oh nee, die will ich nicht schon wieder hören.
Ich frage mich, wie geht das zusammen, Schreiben und Kochen?
Ich schreib ja nicht.
Genau, aber das ist vielleicht der springende Punkt. Sie übersetzen. Es geht um Übersetzung!
Ja, das stimmt. Frieda Grafe hat ja auch gern übersetzt.
Ja, bei ihr ist das Kochen…
… ist das Kochen auch ein Übersetzen, nämlich das, was ein anderer sich ausgedacht hat und gekocht hat. Das guckt man sich an. Und man sagt, ich probier’s aus, ob ich das auch kann. Das ist ja auch ein Übersetzen, das geht dann schon zusammen.
Das ist die Übersetzung eines Rezepts in die Wirklichkeit sozusagen.
…in die Realisierung. Jetzt passt das Wort endlich mal (lacht). Statt dass man sagt, ich realisiere ja, was sie meinen.
Und beim Film? Wie ist das da?
Was beim Schreiben über Film das Übersetzen ist? Ja, dass man aus der Filmsprache jetzt eine verbale Sprache macht.
Es geht also um eine sprachliche Übersetzung.
Die Übersetzung von einem Bild ins Gesprochene.
Außerdem geht es ja stark um den sinnlichen Reiz, also des Essens und des Filmeschauens.
Frieda hat bei der Übersetzung des Alice B. Toklas Cook Book jedes einzelne Rezept nachgekocht. Ich war sehr beeindruckt davon.
Auch die Haschkekse?
Alles. Die Haschkekse hat meine Schwester auch mal gemacht, und meine jüngste Schwester hat davon auch probiert. Die war dann ziemlich high.
Mein erster Versuch, ein Rezept aus dem Buch zu realisieren, war dieser französische Kuchen, der mit Löffelbiskuit gemacht wird, wie heißt der noch?
Ich weiß, die Charlotte!
Genau, die Charlotte. Aber die ist mir völlig missglückt.
Die Rezepte sind nicht alle gut, die sind zu schwer, zu altmodisch.
PS: Ein paar Tage nach unserem Gespräch schickte mir Melanie Walz ein Charlottenrezept per Mail:
Erdbeer- oder Himbeercharlotte (nach Lenôtre): Vanillesauce aus 1/4 l Milch mit 3 Eigelb, 1/2 Vanilleschote (nur das Mark) und 75 g Zucker – Milch aufkochen, Vanilleschote gespalten einlegen (oder gleich nur das Mark), 10 Minuten ziehen lassen und etwas auskühlen lassen, Eigelb mit Zucker schaumig schlagen, mit lauwarmer Milch gut mischen, unter stetigem Rühren vorsichtig erwärmen (darf nicht kochen), wenn genug angedickt, in kaltem Wasser abkühlen (dauert etwa eine halbe Stunde). – 2 Blatt Gelatine, Erdbeere- oder Himbeersauce aus 500 g Früchten (mit 300 g Zucker mixen oder gründlich zermantschen), 200 g Schlagsahne (mit 1 EL Vanillezucker geschlagen, bis fest), Löffel-Biskuits, Zucker, 200 g frische Beeren, 1 Kastenform. – Vanillesauce bereiten, solange noch warm, die in kaltem Wasser eingeweichte Gelatine einrühren. Sauce abkühlen. Sahne aufschlagen und unter die abgekühlte Vanillesauce geben. – Wände der Kastenform mit Butter einstreichen und mit den unten abgeschnittenen Löffelbiskuits rundum auskleiden. Boden der Form mit Zucker bestreuen. Die Form abwechselnd mit der Vanillemasse und frischen zerkleinerten Beeren bis oben füllen. Zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Dann ganz kurz in heißes Wasser tauchen, damit der Zucker am Boden der Form sich verflüssigt, und auf eine Platte stürzen. Etwas übrige Fruchtsauce auf die Charlotte träufeln, den eventuellen Rest der Sauce separat servieren.

































