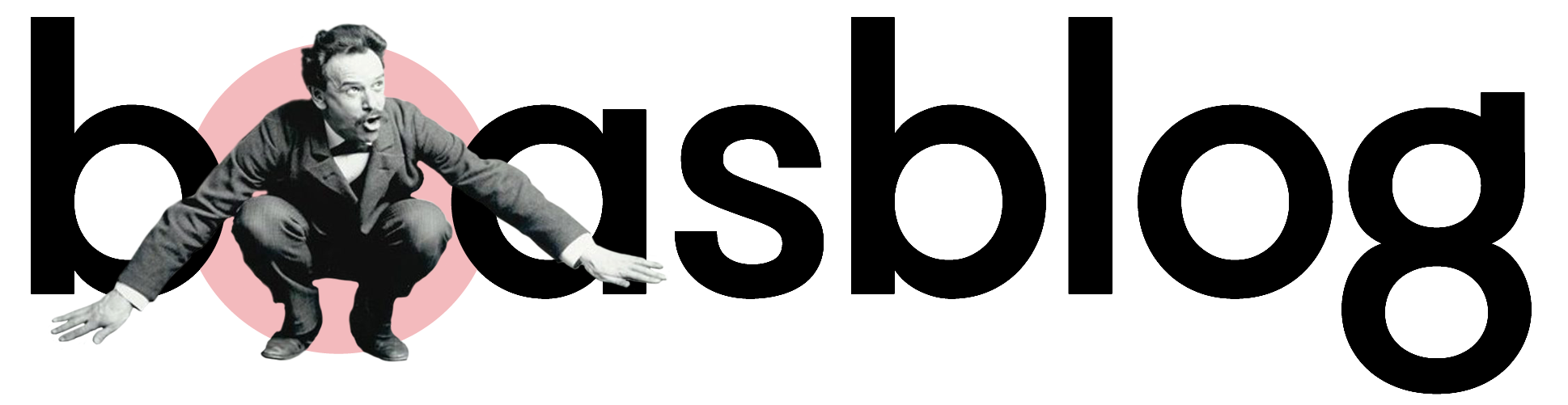Zwischen Universalsprache, Fachthesaurus und lokalem Wissen
Normdaten für ethnologische Inhalte im Kontext von Open Science, Linked Open Data und Dekolonisierungsbemühungen

Foto: Kathleen Heft, Bildbearbeitung: Lea Farah Heiser, CC BY-SA 4.0
„Open Science is at the centre of European research policy“ konstatiert die Europäische Kommission.[1] Europäische Wissenschaft und Forschung sollen durch ihre Öffnung effizienter, produktiver und transparenter werden und damit besser die Bedürfnisse und Erwartungen von Politik und Gesellschaft erfüllen. Dafür muss das Wissen möglichst offen zirkulieren, um den Austausch zu erleichtern und somit Forschungs- und Erkenntnisprozesse zu beschleunigen. Damit das Wissen frei zirkulieren kann, muss es aber auch gut auffindbar und nutzbar sein – Wissen und Daten sollen FAIR sein. Das Akronym wird in Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable aufgelöst, fordert also Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit.[2] Ethnologisches Wissen ist nicht immer leicht zu finden. Es verbirgt sich in Büchern und Zeitschriftenartikeln, Filmen, Museumsobjekten – aber zunehmend auch Webseiten, Podcasts, Comics und anderen Veröffentlichungs- und Verarbeitungsformen. Es liegt auch in den so genannten Forschungsdaten vor, also dem Material, das während der Forschung gesammelt und ausgewertet wurde (Interviews, Beobachtungsprotokolle, Feldtagebücher, Fotos, Filme etc.). Wenn Forschende diese vielfältigen Wissensmanifestationen finden wollen, sind sie – wenn man von persönlichen Kontakten absieht – auf Suchinstrumente und offene Zugriffsmöglichkeiten, also auf Open Access und Open Data angewiesen.
Digitaler Wandel der Suchstrategien
Durch die Digitalisierung der Forschungs- oder Arbeitsprozesse, aber auch zunehmend des Publikationswesens, haben sich die Findmittel und Suchstrategien verändert. Statt gedruckter Kataloge und Findbücher sind es heute meist internetbasierte Suchinstrumente. Das können kommerzielle Suchmaschinen und Suchportale sein, für die Universitäten Geld bezahlen (z.B. Scopus oder EBSCOhost), oder die digitalen Nachweisinstrumente wissenschaftlicher Einrichtungen, wie Bibliothekskataloge, Fachportale oder Museumsdatenbanken. Diese Nutzung von Datenbanken sowie digitalen Ressourcen wird in der Forschung und im akademischen Publikationswesen nicht nur im Zuge der Open-Science-Forderungen wichtiger. Es wird einerseits mehr digital publiziert und darüber hinaus werden ehemals nur gedruckt vorliegende Ressourcen durch Digitalisierung ebenfalls Teil des digitalen Raums. Dies kann digitale Findbücher in Archiven, aber auch Ressourcen in Forschungsdatenrepositorien und Fachportalen bis hin zu thematisch sehr umfassenden spartenübergreifenden Portalen wie Europeana umfassen. Der Prozess der Digitalisierung macht Wissen zugänglicher und bietet somit Potential für die Forschung, geht aber gleichermaßen mit Herausforderungen einher. Ethisch-politische Implikationen umfassen Fragen danach, was in welcher Form digitalisiert, präsentiert und zugänglich gemacht werden soll.[3]
Suchstrategien und Metadaten
Um das Wissen in diesen Instrumenten durchsuch- und auffindbar zu machen, gibt es verschiedene Wege:
- Volltextsuche: Der gesamte Text wird für die entsprechende Suchmaschine ausgewertet und Suchtreffer werden nach hinterlegten Algorithmen „gerankt“. Trainierte „Künstliche Intelligenzen“ (meist so genannte Large Language Models – LLMs) erkennen mittlerweile teilweise auch enthaltene Bildinhalte.
- Metadatenbasierte Suche: Metadaten, also beschreibende Angaben zu den Wissenselementen (Informationen zu Autor:innen, Titel, Erscheinungsformaten, Erscheinungsjahren, Inhaltsangaben über Abstracts, Schlagwörter oder Stichwörter), werden ausgewertet. Treffer in diesen Metadaten werden häufig höher gerankt als Suchtreffer aus der Volltextsuche.
Normdaten als Instrumente der Wissensorganisation
Die Vergabe und Verzeichnung von Metadaten wird in Bibliotheken Erschließung genannt. Für viele Infrastruktureinrichtungen sind Normdaten und kontrollierte Vokabulare zentrale Instrumente der Erschließung und Wissensorganisation. Auf Grundlage von redaktionellen Entscheidungen legen Wissensorganisationssysteme – beispielsweise kontrollierte Vokabulare, Normdaten – fest, wie Sachverhalte bezeichnet werden sollen und weisen diesen einen eigenen Identifikator in einem gesonderten Datensatz zu. Diese Systeme zielen darauf ab, die Mehrdeutigkeit von Sprache zu reduzieren und Wissen zu systematisieren. Der vergebene Identifikator dient dazu, dass auch Maschinen eine eindeutige Zuordnung treffen können – Wissen wird so interoperabel. Die in diesem Prozess erzeugten Metadaten bieten bei der Suche den Vorteil, dass sie – in einer normierten Form – zu Kategorienbildungen führen können, nach denen gefiltert werden kann oder dass sie eindeutig festlegen, um was für Entitäten (Personen, geografische Orte, Körperschaften, Sachinhalte etc.) es sich bei den entsprechenden Bezeichnungen handelt.
Dies ist für die eindeutige Identifizierung von Personen relevant: Der Michael Müller aus dem ausgewerteten Volltext ist – ohne eine automatisierte oder händische Verknüpfung mit einem Normdatensatz – nicht eindeutig bestimmbar (analog für Sachverhalte – beispielsweise Bank als Geldinstitut versus Sitzmöbel). Bei bibliothekarischen Metadaten werden hingegen fast immer normierte Daten verwendet, um gerade solche Fälle eindeutig zu gestalten.
Die Gemeinsame Normdatei (GND)
Für den deutschsprachigen Raum stellt die Gemeinsame Normdatei (GND) das zentrale Instrument der Wissensorganisation in Bibliotheken dar. Ursprünglich aus dem bibliothekarischen Kontext kommend, findet diese mittlerweile im gesamten GLAM-Bereich und weiteren Webkontexten vielfach Anwendung. Sie umfasst mittlerweile circa 10 Millionen Datensätze für unter anderem Personen, Sachbegriffe und geografische Einheiten. Gepflegt wird sie hauptsächlich durch ein Redaktionsnetzwerk der deutschsprachigen Bibliotheksverbünde, wobei sich in den letzten Jahren auch zunehmend Redaktionen aus anderen Bereichen etabliert haben und es via Kontaktformularen ebenfalls für Außenstehende die Möglichkeit gibt, beispielsweise Personendatensätze zu ergänzen oder zu erstellen.[4]
In der GND wird festgelegt, um welchen der derzeit über 700 dort verzeichneten Michael Müllers es sich handelt. Dabei wird im Prozess der Datensatzerstellung der bevorzugte Name der Person ausgewählt, gleichzeitig können alternative Schreibweisen oder auch ehemalige Namen hinterlegt werden. Mittels der Ergänzung von biografischen Angaben lassen sich Personen eindeutig referenzier- und auffindbar machen.
Darüber hinaus können die Datensätze mit abweichenden Benennungen, Definitionen und Quellen angereichert werden sowie in ein Netzwerk von verwandten sowie Ober- und Unterbegriffen eingefügt werden. Dies dient der Verortung von Begriffen und macht deutlich, welcher thematische Anwendungsbereich davon abgedeckt wird, beispielsweise finden gleichlautende Begriffe sowohl in der Biologie als auch den Sozialwissenschaften Anwendung und müssen entsprechend definiert werden.
Neben diesem breiten Kreis an Anwendenden und der sehr großen Anzahl von bereits existenten Datensätzen bietet die GND eine ganze Reihe weiterer Vorteile:
- Die GND wird nachhaltig gepflegt und regelmäßig aktualisiert.
- Sie lässt sich für verschiedene Anwendungskontexte nutzen, seien es Downloads für Massenanalysen oder den (maschinellen) Austausch über verschiedene Systeme hinweg.
- Sie ist mit anderen fremdsprachigen Systemen verknüpft, sodass ein hohes Maß an internationaler Anwendbarkeit und mehrsprachige Suchen möglich sind.
- Mittels Regelwerken werden Arbeitsprozesse klar strukturiert, sodass die Datenqualität hoch ist und Datensätze kongruent erstellt werden.
- Die strukturierte Form der Normdatei ermöglicht automatisiert durchgeführte Abgleiche mit textbasierten Ressourcen: Über maschinell gefundene Schnittmengen werden den Ressourcen GND-Datensätze als Schlagwörter zugeordnet. Solche Verfahren können die intellektuelle Erschließung durch Personen gerade im Hinblick auf große und rasant wachsende Wissensbestände ergänzen.
Vernetzung und Linked Data
Eine solche Festlegung von Entitäten anhand von Normdateien und Thesauri ermöglicht auch eine Verknüpfung von Datensätzen, die gerade durch die Digitalisierung ihre Vorteile entfaltet: Durch normierte Begriffe und Entitäten lässt sich per Klick eine Suchmenge der Wissenselemente erzeugen, die mit den gleichen Begriffen verknüpft wurden, beispielsweise weil sie von denselben Autor:innen erstellt wurden oder im gleichen Verlag erschienen sind, ähnliche Inhalte behandeln, Forschungen über denselben Ort oder dieselbe Person sind. Somit ermöglichen sie, bereits erschlossene Bestände aus verschiedenen Quellen miteinander verlässlich auszutauschen, automatisiert zu verknüpfen und gemeinsam in übergeordnete Kataloge einzuspielen, sodass sie über verschiedene Portale hinweg besser durchsuchbar und somit zugänglich werden. Normdaten ermöglichen auf diesem Wege ein höheres Maß an Interoperabilität von Wissensbeständen – ganz im Sinne der FAIR-Prinzipien. Ohne sie ist eine Auffindbarkeit der Ressourcen im digitalen und analogen Bereich deutlich erschwert.
Eng verbunden mit digitalen Ressourcenbeständen und normierter Erschließung ist das Konzept von Linked Data beziehungsweise dem Semantic Web. Linked Data verknüpft Ressourcen aus unterschiedlichen Datenquellen miteinander und ermöglicht vielfältige Anwendungskontexte. Diese Verknüpfungen kann man sich auch in so genannten Wissensgraphen[5] visualisiert anzeigen lassen, eine Darstellungsform, die etwa zur Veranschaulichung von Wissensbezügen in Nachlassmaterialien oder Wissensnetzwerken in der Wissenschaft hilfreich sein kann.
Kritische Perspektiven auf Wissensorganisationssysteme
Die Normierung von Wissen in Thesauri und Normdateien basiert sehr stark auf Wissenssystemen, die von ihrer jeweiligen Wissenschaftskultur geprägt sind. Sie sind geprägt durch spezifische Perspektiven, die mit Leerstellen und Verzerrungen einhergehen können. So ist die Gemeinsame Normdatei eng an den deutschsprachigen Raum gekoppelt. Sie ist im engeren Sinne auch kein wissenschaftlicher Thesaurus, sondern ein universalsprachliches Instrument, das auch dem Publikum öffentlicher Bibliotheken bei Katalogsuchen weiterhelfen soll. Die auf diese Weise erzeugten Metadaten wurden dabei bis vor kurzem hauptsächlich mit Fokus auf Standardisierbar-, Austauschbar- und Nachnutzbarkeit diskutiert. Das Ziel der universellen Anwendbarkeit der Systeme trifft dabei auf fachspezifische Sichtweisen und Ansprüche als auch auf Kritik, beispielsweise aus geschlechter- beziehungsweise queertheoretischer oder postkolonialer Perspektive.
Insbesondere der Prozess der Digitalisierung und die damit einhergehende weltweite Sichtbarkeit von Beständen und deren Metadaten machen die Öffnung und kritische Analyse der Wissensorganisationssysteme bedeutsamer. Die meisten Wissensorganisationssysteme sind bedingt durch ihren Aufbau und ihren Umfang von einer Sicht auf die Welt geformt, die im globalen Norden verortet ist. Sie sind immer auch eingebunden in spezifische politisch-kulturelle sowie soziale Kontexte.[6] Datensätze wurden dann erstellt, wenn beispielsweise das (deutschsprachige) Publikationsaufkommen diese notwendig machte. Die Festlegung auf eine möglichst allgemeinverständliche bevorzugte Benennung mit Rückgriff auf Quellen des Globalen Nordens in Form von spezifischen Nachschlagewerken führt zur Bevorzugung von bestimmten Begriffen und Definitionen.
Durch diesen Rückgriff und weitere Regeln der Datensatzerstellung sind nur vermeintlich neutrale Bezeichnungen möglich; vielmehr sind diese Resultat ideologisch-historischer eingebundener Arbeitsprozesse. So kommt das Cataloging Ethics Steering Committee, das Mitglieder aus dem Bereich der Katalogisierung in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich umfasst, zum Schluss, dass diese Standards nicht wertfrei und durch problematische Perspektiven sowie Machtverhältnisse geprägt seien: „Cataloguing standards and practices are currently and historically characterised by racism, white supremacy, colonialism, othering, and oppression. We recognise that neither cataloguing nor cataloguers are neutral, and we endorse critical cataloguing as an approach to our shared work with the goal of making metadata inclusive and resources accessible.“[7]
Diese Analyse umfasst ethisch-politische Implikationen, die mit Wissensorganisationssystemen einhergehen und befragt diese hinsichtlich ihrer Verortung, Multiperspektivität und darin repräsentierten Machtverhältnisse.
Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind:
- Was findet Eingang in die Systeme und was nicht?
- Wie sind diese Systeme historisch entstanden und welche Perspektive ist deshalb vorherrschend?
- Wer hat die Möglichkeit der aktiven Partizipation? Wer ist von der Teilhabe ausgeschlossen?
- Wie ist das Verhältnis zwischen auf universeller Gültigkeit abzielenden Wissensorganisationssystemen, domänenspezifischen Systemen und lokalem Wissen?
Folgen für marginalisierte Gruppen und Wissen
Diese Herstellungsprozesse können zur Folge haben, dass bestimmte Bereiche des Lebenszusammenhangs einer Gruppe innerhalb des Wissensorganisationssystems nicht oder nur in unpräziser beziehungsweise vereinfachter Form repräsentiert sind. Des Weiteren können die vorhandenen Datensätze problematische oder unpassende Bezeichnungen für die Beschreibung der Individuen oder ihres Lebenszusammenhanges besitzen. Dies besitzt besondere Relevanz, wenn es um die Teilhabe und Repräsentation von marginalisierten Gruppen in diesen Systemen geht z.B. in Hinblick auf indigene Gemeinschaften oder die LGBTQI-Gemeinschaft. Ein Mangel an Repräsentation oder problematische und diskriminierende Bezeichnungen können Nutzende davon abhalten, die Nachweissysteme zu nutzen, beziehungsweise den Zugang zu Ressourcen erschweren.[8]
Handlungsoptionen und Lösungsansätze
Trotz dieser Einschränkungen bestehen verschiedene Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich[9]:
- Es ist sinnvoll die spezifischen Datensätze innerhalb der Systeme zu überarbeiten oder zu ergänzen, etwa um damit Leerstellen zu füllen.[10] Dies umfasst das Einbinden von Bedarfen der Nutzer:innen, was mitunter durch die notwendigen Recherchen oder den Dialog ein sehr arbeitsintensiver Prozess sein kann. Durch kooperatives Vorgehen und die Öffnung der Wissensorganisationssysteme wird ein höheres Maß an Partizipation anvisiert, das den Kreis derjenigen Personen erweitert, die Einfluss auf deren Gestaltung nehmen können.
- Eine Vernetzung mit anderen Vokabularen kann Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit fördern und damit Bestände über Sprachgrenzen hinweg zugänglicher machen.[11]
- Schließlich kann die Entwicklung und Anwendung von alternativen kontrollierten Vokabularen eine Möglichkeit sein. Diese haben den Vorteil, dass sie Perspektiven umfassend und mit weniger Kompromissen aufnehmen sowie sich eigene Regeln und Strukturen geben können.[12] Dies können fach- oder gruppenspezifische Vokabulare sein, die beispielsweise lokales Wissen aufgreifen können. Problematisch kann sein, dass diese ohne einen größeren Redaktionskreis oftmals nicht nachhaltig gepflegt werden können und je nach technischer Implementierung die Vernetzung mit anderen Systemen und damit die Austauschbarkeit, also die Interoperabilität über Sammlungsgrenzen hinweg nur eingeschränkt möglich ist.
Die Erweiterung oder Überarbeitung von Datensätzen ist ein bedeutender Ansatz hin zu zeitgemäßen und inklusiveren Anwendungen. Nichtsdestotrotz basieren diese Änderungen auf der grundsätzlichen Struktur und damit einhergehenden Beschränkungen der Wissensorganisationssysteme. Verzerrungen und Ausschlüsse sind inhärenter Teil dieser Systeme. Der Erstellung und Überarbeitung von Datensätzen sind unter anderem durch Sprachwandel bedingt ein andauernder Prozess, der sich nicht endgültig abschließen lässt. Dabei kann es mitunter sogar sinnvoll sein alte Begrifflichkeiten zu bewahren, um der historischen Forschung und Benutzer:innen die historisch-ideologische Eingebundenheit und Begrenztheit jeglichen Wissensorganisationssystems näher zu bringen.[13]
Zwischen Notwendigkeit und Kritik
Um Wissen zu vernetzen und strukturiert auffindbar zu machen, ist der Rückgriff auf Wissensorganisationssysteme essenziell. Diese müssen sowohl technisch anschlussfähig als auch dauerhaft gepflegt werden. Dies gewährleisten große Universalsysteme wie die GND. Zugleich müssen diese Systeme immer auf eine mögliche Öffnung hin zu diverser Repräsentation und Vielstimmigkeit befragt werden. Dialog und Kooperation sind hierbei wichtige Bestandteile. Ihre technische Komplexität und ihre angestrebte universelle Anwendbarkeit, also die allgemeine Verständlichkeit in der (hier westlich geprägten) Gesellschaft machen es schwierig, diese Vielstimmigkeit immer zu berücksichtigen. Der große Anwender:innenkreis macht zusätzlich klare Arbeitsabläufe und Richtlinien unabdingbar, die jedoch dazu führen, dass Anpassungsmöglichkeiten mitunter eingeschränkt sind. Der Prozess der Öffnung und Integration ist immer in einem Spannungsverhältnis zwischen praktischer Durchführbarkeit und (ethischen) Ansprüchen eingebunden, dies gilt für Wissensorganisationssysteme, Linked Data und Open Science gleichermaßen: Wie breit soll ethnologisches Wissen mit seinen spezifischen sensiblen Inhalten zirkulieren – kann eine Wahrnehmung in wissenschaftlichen Kreisen mitunter gar ausreichen und inwiefern schützt eine limitierte Zirkulation mitunter die Interessen der Forschungspartner:innen aus dem Feld? Die Stimmen sind hier vielfältig: Das Feld fordert nicht einhellig Schutzmaßnahmen – in Richtung von Zensur aus kulturellem Respekt – sondern oftmals zunächst Zugänglichmachung des Materials. Das ist meist gekoppelt mit der Forderung der besseren Auffindbarkeit – Mehrsprachigkeit und verknüpfte Normdaten können hier ein Lösungsweg sein, so westlich geprägt sie auch sein mögen. Und auch die Wissenschaft problematisiert des Öfteren die schlechte Auffindbarkeit und mangelnde Zugänglichkeit von Wissen – bei gleichzeitiger Diskussion der Fallstricke von allzu großer Offenheit. Die Infrastruktureinrichtungen haben ihre vermittelnde Position in dem Spannungsverhältnis erkannt und nehmen diese Aufgabe zunehmend an.
Literatur
Drabinski, Emily (2013): Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction. In: Library Quarterly: Information, Community, Policy 83 (2), S. 94–111: 109. https://doi.org/10.1086/669547.
Gartner, Richard (2016): Metadata. Shaping Knowledge from Antiquity to the Semantic Web. Basel: Springer: 42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40893-4.
Rizzolli, Michaela; Imeri, Sabine (2022): CARE Principles for Indigenous Data Governance. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, Bd. 9 Nr. 2 (2022). https://doi.org/10.5282/o-bib/5815.
Turner, Hannah (2020): Cataloguing culture. Legacies of colonialism in museum documentation. Vancouver, Toronto: UBC Press: 159.
Watson, B. M. (2021): Advancing Equitable Cataloging. In: Proceedings from North American Symposium on Knowledge Organization 8: 9-10. https://doi.org/10.7152/nasko.v8i1.15887.
Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, I. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific data 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 lizenziert. Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung der Urheber:innen die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Die Grafik ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 lizenziert. Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung der Urheber:innen die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. Wenn Sie das Material bearbeiten, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Matthias Harbeck studierte Geschichte, Ethnologie und Politik an der Universität Hamburg und Informations- und Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2009 ist er Fachreferent für Ethnologie an der UB der Humboldt-Universität zu Berlin, seit 2016 leitet er den DFG-geförderten Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie.
Moritz Strickert (https://orcid.org/0000-0001-9626-5932) studierte Soziologie und Ethnologie an der Universität Bremen und Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Derzeit ist er Mitarbeiter des Fachinformationsdienstes Sozial- und Kulturanthropologie (FID SKA). Er arbeitet in einem Projekt zur Gemeinsamen Normdatei (GND) aus ethnologischer Perspektive und ist in der Arbeitsgruppe Thesauri des Netzwerks für nachhaltige Forschungsstrukturen in kolonialen Kontexten aktiv.
[1] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en [abgerufen am 25.07.2025].
[2] Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, I. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific data 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.
[3] Einen Anknüpfungspunkt liefern hier die CARE-Prinzipien (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics), die dem FAIR-Ansatz oftmals zu Seite gestellt werden. Jene besitzen jedoch keinen übergreifenden Anspruch, sondern legen den Fokus auf indigene Kontexte. Siehe hierzu: Rizzolli, Michaela; Imeri, Sabine (2022): CARE Principles for Indigenous Data Governance. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, Bd. 9 Nr. 2 (2022). DOI: https://doi.org/10.5282/o-bib/5815.
[4] Für eine kompakte Übersicht hinsichtlich Erschließungspraktiken, der GND und deren Anwendungspotentiale für Forschenden siehe: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101-2023092119 [abgerufen am 25.07.2025].
[5] Siehe als Beispiel den vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) verantworteten Wissensgraph Bildung: https://www.dipf.de/de/infrastrukturen/infrastrukturentwicklung/wissensgraph-bildung [abgerufen am 25.07.2025].
[6] Gartner, Richard (2016): Metadata. Shaping Knowledge from Antiquity to the Semantic Web. Basel: Springer: 42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40893-4.
[7] Cataloging Ethics Steering Committee (2021): Cataloguing Code of Ethics. Online verfügbar unter https://docs.google.com/document/d/1IBz7nXQPfr3U1P6Xiar9cLAkzoNX_P9fq7eHvzfSlZ0/ [abgerufen am 25.07.2025].
[8] Turner, Hannah (2020): Cataloguing culture. Legacies of colonialism in museum documentation. Vancouver, Toronto: UBC Press: 159.
[9] Für eine umfassende Literaturanalyse von empfohlenen Vorgehensweisen in diesem Bereich siehe: Watson, B. M. (2021): Advancing Equitable Cataloging. In: Proceedings from North American Symposium on Knowledge Organization 8: 9-10. https://doi.org/10.7152/nasko.v8i1.15887.
[10] Für die GND erfolgt dies über ein Teilprojekt des FID Sozial- und Kulturanthropologie, das auf die Überarbeitung und Ergänzung der GND aus ethnologischer Perspektive abzielt.
[11] Aus diesem Grund reichert der FID Sozial- und Kulturanthropologie im Zuge der Arbeit der AG Thesauri im Netzwerk Koloniale Kontexte Datensätze für kulturelle Gruppen an und verknüpft diese mit denen des weit verbreiteten Art and Architecture Thesaurus (AAT).
[12] Ein Beispiel stellt das Respectful Terminology Platform Project betrieben von der kanadischen National Indigenous Knowledge & Language Alliance dar. Dabei handelt es sich um ein mehrsprachiges Wissensorganisationsprojekt für indigene Gruppenbezeichnungen und deren Lebenswelt. Dabei werden derzeit noch in Kulturerbe Einrichtungen verwendete veraltete und unangemessene Begriffe überarbeitet und ersetzt. Weitere Informationen siehe: https://www.nikla-ancla.com/respectful-terminology [abgerufen am 25.07.2025].
[13] Drabinski, Emily (2013): Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction. In: Library Quarterly: Information, Community, Policy 83 (2), S. 94–111: 109. https://doi.org/10.1086/669547.